We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.
Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refusing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.
We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Google reCaptcha Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.
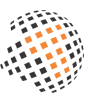
Podcast Stufe Eins
Beginnen wir mit der Technik, meistens das größte Hindernis, trotz der Annahme, dass heute selbst ein Grundschüler einen PC konfigurieren könnte.
Hardware
Vorausgesetzt, der PC ist komplett vorhanden, brauchen wir minimal noch:
Das wäre die Hardware-mäßige Minimal-Ausstattung. Möchte man es semiprofessionell machen, sähe die Liste etwas anders aus:
Für die Minimalkonfiguration ohne USB-Anschluss ist die Sache einfach: die beiden Stecker für Mikro und Hörer sind farblich codiert, grün und rosa, und kommen in die entsprechenden Anschlüsse der Soundkarte des PCs. Für die größere Lösung sollte man schon etwas mit Audiotechnik vertraut sein, schwierig ist es aber auch nicht: USB-Audiointerface mit einem USB-Anschluss des PCs verbinden, Mikro über ein XLR-Kabel auf einen Mikro-Eingang des Interfaces, Hörer an Headphone Out des Interfaces oder am PC, bei Kondensator-Mikrophonen das Einschalten der Phantomversorgung nicht vergessen. Wer etwas über Mischpulte lesen möchte, findet an dieser Stelle einen Artikel dazu. Danach sollte die Unwissenheit über die Bedienung eines Pultes kein Hindernis mehr darstellen. So weit die harte Ware.
Software
In der letzten Zeit hat sich auf der Softwareseite ein kostenloser Standard etabliert: Audacity, kostenlos und erstaunlich leistungsfähig. Bezüglich Konfiguration und Bedienung ist in der Site genug zu finden, so dass auch Unerfahrene schnell zu Ergebnissen kommen. Kleine Tücke ist, dass in der Konfiguration von Audacity bei Verwendung eines USB-Pultes oder Wandlers als Ein- und Ausgang der USB Audio Codec gewählt werden muss.
Tatsächlich ist es ein größerer Schritt, wenn man mit diesem Thema noch nicht beleckt ist, aufzunehmen und zu bearbeiten. Nicht erschrecken, nicht abschrecken lassen und die Anleitungen für Audacity durch arbeiten. Es ist nicht so schwierig, wie es auf den ersten Blick aussieht. Audacity zum Aufnehmen zu wählen, hat eine Menge Vorteile, denn man kann nicht nur Patzer oder Seitenblättern herausschneiden, sondern auch später Jingles oder externe Aufnahmen mit hinein mischen, im Prinzip wie in einem “richtigen” Tonstudio. Und nicht vergessen, sich den LAME MP3 Encoder dazu zu laden, um direkt aus Audacity MP3-Dateien erzeugen zu können.
Die wirklichen Knackpunkte
Nun wollte ich nicht detailliert auf die Hardware und Software eingehen, denn dazu finden sich im Netz genug Hilfen zur Auswahl und zur Konfiguration. Die anderen Fragen sind die, wie man einen solchen Podcast gestaltet und welche sonstigen Voraussetzungen wichtig sind. Diese Geschichte fängt mit der akustischen Gestaltung an.
Macht man seine ersten Aufnahmeversuche, wird man einige Merkwürdigkeiten feststellen, an die man zuerst nicht gedacht hatte. Die eine sind Nebengeräusche, da fährt ein LKW am Haus vorbei, der Nachbar geht duschen oder der Tisch macht Geräusche, so bald man sich auch nur minimal bewegt. Von Maus-Clicks ganz zu schweigen, oder der PC-Lüfter ist im Hintergrund zu hören. Die Clicks beim Starten der Aufnahme sind noch das kleinste Problem, die kann man in Audacity (ich nutze n-Track zum Mischen und Goldwave zum Aufnehmen und Bearbeiten) herausschneiden, ebenso Geräusche, die in Sprechpausen entstanden sind. Aber den LKW oder die Dusche eben nicht. Daher empfiehlt sich für das Aufnehmen ein möglichst geschützter Raum, in dem keine Nebengeräusche zu hören sind. Bei mir ist das der Keller, dort habe ich einen stabilen Tisch und sämtliches Equipment, so dass ich nicht auf- oder abzubauen brauche. Und die einzige mögliche Störquelle ist ein Wasserrohr, aber das alles ist berechenbar. Von einem Amerikaner habe ich gelesen, dass er im Abstellraum aufnimmt. Auch eine Variante.
Speaker’s Booth
Die Möglichkeit, sein Studio im Keller zu errichten, ist sicher nahe am Optimalen, weil es dort meistens am ruhigsten ist. Aber dann kommt ein neues Problemchen auf: Raumakustik. Es ist hallig, die nackten Wände eines Kellers sorgen für eine unruhige Akustik, die Stimme verschwimmt. Dazu muss nicht mal ein Keller her, in so manchem größeren Wohnzimmer oder Arbeitszimmer hat man genug Raumhall, der die Verständlichkeit stört. Es klingt einfach schlecht. Bei einem Headset tritt dieser Effekt übrigens nicht so ausgeprägt auf, ein Großmembran-Kondensatormikrophon dagegen lässt selbst einen unruhigen Fuß noch klar in der Aufnahme präsent werden. Dagegen hilft nur eins: Dämmen. Da man im Keller wohl weniger Ärger mit der Dame des Hauses bekommt, wenn man die Wände mit Dämmmatten tapeziert, diese sind ein probates Mittel, bekommt der Keller wieder Attraktivität. Ansonsten helfen Teppiche, Vorhänge oder Polstermöbel. Wie man den Raum nun akustisch trockener bekommt, ist sehr individuell. Ist der Raum groß, ist es günstiger, die Dämmungen auf Schaumplatten oder Sperrholz zu kleben und mittels Holzlatten ein Gestell zu bauen, das die Konstruktion im Raum frei platzierbar macht. So in meinem Keller geschehen. Dann brauchen zwar noch ein oder zwei Wände eine Dämmung, aber es hält sich geldlich und optisch im Rahmen. Tatsächlich sollte man sehen, dass man den Raum akustisch so trocken wie möglich bekommt. Professionelle Studios haben einen Speaker’s Booth, einen kleinen Raum, der akustisch sehr ruhig ist, mit einem Fenster zur Kommunikation. In diese Richtung sollte man möglichst kommen. Es muss übrigens gar nicht so teuer werden, sein Studio auszustatten. Um die Kellerregale zu verstecken und den Raum weiter zu dämmen, habe ich billige Decken von IKEA und eine Vorhangstange verwendet. Macht das Kellerstudio wohnlicher und akustisch angenehmer. Die Dämmmatten kann man von Thomann kaufen, manche Schaumstoffhändler haben diese aber auch als Verpackungsmaterial.
Sind diese Fragen gelöst und man vielleicht sogar seinen eigenen Speaker’s Booth, bleibt noch das Material als Störquelle. Viele PCs haben einen Lüfter, der laut und vernehmlich tönt, was dann in der Aufnahme nicht zu überhören ist. Ideal sind daher Netbooks und Nettops, die keinen Lüfter haben, oder nur einen sehr kleinen und leisen. Aber auch professionelle PCs, die gebraucht schon um die 150 Euro zu bekommen sind, können erstaunlich leise sein. Mein Fujitsu ESPRIMO E5915 jault beim Verbinden mit dem Stromnetz einmal auf, danach ist er aber nicht mehr zu hören. Bestehen diese materiellen Möglichkeiten nicht, kann man mit Hilfe eines Reparatur-fähigen PC-Händlers versuchen, seinen Rechner leiser zu bekommen, zum Beispiel durch Montage von Gummidämpfern für Lüfter und Festplatten, oder durch Austausch des Netzteiles. Letztes Mittel ist ein großer Karton, der innen mit Dämmplatten beklebt wird, aber noch Platz für den Wärmeaustausch lässt, so dass der PC sein eigenes Speaker’s Booth bekommt und nicht so sehr durch Geräusche stört.
Problem gelöst, neue Probleme
Hat man das alles hin bekommen, alle Hardware und Software am Laufen, sein schönes und inspirierendes Plätzchen, dann, ja dann geht es an die Inhalte selbst. Vorausgesetzt, man hat es Ideen, was man in seinem Podcast machen möchte, können ein paar Gedanken über die Ausgestaltung nicht falsch sein.
Es gibt Leute, die schreiben sich für eine halbe Stunde Sprechen drei Stichworte auf eine Karteikarte und leisten sich nicht ein einziges Äh. Andere schreiben den kompletten Text aus und verhaspeln sich doch achtmal. Ich denke, es kommt auf den Text an. Ist man mit den Themen sehr vertraut, ist freies Sprechen mit einiger Übung möglich. Ablesen von Text verleitet zu eher monotonem Sprechen, was absolut kontraproduktiv ist, denn die Hörer schlafen ein oder schalten ab. Man muss an diesem Punkt seine eigene Wohlfühlgrenze ausloten, wie viel an Inhalt und Text man vorproduziert. Zu bedenken ist, dass man den Text dann auch vor Augen haben muss, so kommen die Probleme mit raschelndem Papier oder Maus- und Tastaturgeräuschen wieder in den Vordergrund. Und man kann nicht alles heraus schneiden, was stört, wenn es hinter der Sprache liegt. Optimal ist es, wenn die Notizen auf eine DIN A4-Seite passen, oder auf einen Bildschirm. Und das groß genug, denn je größer die Schrift, desto weniger Gefahr sich zu verhaspeln oder im Text zu verlieren. Ausprobieren.
Nichts ist gefährlicher als eine langweilige Stimmführung, nichts ist nerviger als eine Wiedergabe mit Pop-Geräuschen bei den explosiven Konsonanten oder ein zu leiser Sprecher, nichts ist einschläfernder als eine Kettung von Bandwurmsätzen oder eine Sprache, die von Substantiven überquillt, Beamtensprache. Den ersten Punkt muss man üben und man muss sich trauen, variabler und mit weiterer Stimmführung als vielleicht im Alltag zu sprechen. Die Pop-Geräusche kann der Filter vermeiden, man sollte aber auf dem Abstand zum Mikro achten, eine Handspanne ist meistens am besten, für den Pegel die Anzeigen in der Aufnahmesoftware beachten, der Pegel sollte so bei -3 bis -6dB liegen. Ein Software-Kompressor (soft knee) in der Aufnahmesoftware hilft, Übersteuerungen zu vermeiden. Bleibt die Sprache als solche, daran muss man, wie bei den Webinaren schon geschildert, arbeiten. Die Texte sollten abwechselungsreich und farbig, aber nicht grell oder schrill sein.
Blieben noch die übrigen Gestaltungsmöglichkeiten. Jingles, also Musiksequenzen oder andere Einstreuungen, sind hilfreich für den Wiedererkennungswert und wecken ein wenig, brechen die längeren Textsequenzen auf. Aber Finger weg von urheberrechtlich geschütztem Material von CDs oder aus dem Netz, das kann teuer werden. Entweder nach freien Jingles suchen, oder selbst welche gestalten. Musiker an Gitarre oder Klavier/Keyboard sind hier besser dran. Ansonsten sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt: Außenaufnahmen mit einem Diktiergerät, Familie oder Freunde um Abschnittsbeiträge bitten, den Text mit unauffälligen Sounds unterlegen. Also z. B. Musik ohne Soloinstrumente oder Gesang, möglichst gleichförmig. Hier kommt die Kreativität ins Spiel und der Bereich, wo der individuelle Podcast gestaltet wird.
Vom eigentlichen Thema ganz abgesehen. Denn das bleibt das Schwierigste.